 Ich bin ein Republikflüchtling.
Ich bin ein Republikflüchtling.
Nur in die falsche Richtung: von West nach Ost. Aber zum richtigen Zeitpunkt: Seit über zwei Jahren erlebe ich den deutschen Osten, den viele nichtsahnend-vorurteilsbeladen gerne den „wilden“ nennen, live.
Den Umzug von Bonn nach Dresden haben die Freunde im Rheinland bis heute nicht verstanden wo es doch in Poppelsdorf so schön ist!
Gar keine Frage: Schön ist es in Dresden auch. Obwohl, zumindest abseits der Touristenpfade, vieles einen sehr morbiden Charme ausstrahlt. Aber das ist es ja gerade: Wo im Westen alles proper und ordentlich blitzt und funkelt, ist es im Osten graubraun und chaotisch. Wo der Westmensch seit Jahrzehnten sein Leben in angenehm eingefahrenen Bahnen lebt, schwimmt der Ostler in den unendlichen Weiten zwischen alten Seilschaften und neuen Kungeleien, zwischen Selbstbewußtsein und Entmündigung. Und als Wessi steckst du mittendrin und weißt manchmal nicht, was das alles soll.
Wie ist es denn nun im Osten? „Nicht wirklich schön“, sagt Kathrin. Sie kommt auch aus dem Westen und hat ihren Traumjob in Dresden gefunden. Eigentlich gefällt es ihr auch, aber manchmal ruft sie an und sagt, daß sie nun dringend jemand braucht zum Reden. Und beim Wein sprudelt es dann aus ihr heraus: Die Leute rund um sie herum seien sooo merkwürdig! So verbiestert‚ so stur und – und dann stoppt sie, nimmt einen Schluck vom Pinot Grigio, lächelt und sagt: „Aber eigentlich sind sie doch ganz nett…“
Mit diesem Zwiespalt leben allerdings auch die Leute, die schon (je nach Lebensalter) bis zu 40 Jahre mehr oder weniger realen Sozialismus mitgemacht haben. Wenn der erste Eindruck immer der kräftigste ist, dann können sie einem schon leid tun, die Schweriner, Dessauer, Weimarer oder Dresdner und all die anderen: Was da im Sommer 1990 mit der „Wirtschafts, Währungs- und Sozialunion“ gen Osten zog, war nämlich keineswegs ein repräsentativer Durchschnitt des West-Bundesbürgers. Viele kamen, um hier das große Geschäft zu machen. Da mag man es den Bürgern der damals nur noch irreal existierenden DDR gar nicht verdenken, daß sie schnell den Begriff Wessi fanden und daraus ein vielseitig einsetzbares Schimpfwort machten.
„Darf ich dir Herrn van Stipriaan vorstellen? Er kommt aus dem Westen und will hier abzocken!“ stellte mich einmal jemand seiner Freundin vor. Sollte ein Scherz sein, aber bekanntlich können ja auch Witze entlarven. Und ein Drucker in Meißen hatte für einen Auftrag in seinem Computer einen eigenen Ordner angelegt, den er nicht etwa (wie sonst bei ihm üblich) nach dem Projekt oder dem Firmennamen seines Kunden benannt hatte. Nein, der Ordner hieß schlicht und abwertend Wessi. Ich lasse jetzt woanders drucken, obwohl ich sonst nicht nachtragend bin. Der Mensch mit der Abzock-Vorstellung ist mittlerweile einer der besten Freunde hier in Dresden.
Wo wir gerade bei den Menschen sind. Man kann sie ja bekanntlich nicht alle über einen Kamm scheren – aber irgendwie sind die Menschen hier anders.
Richtig ist: Vielen ist nach dem, was man die Wende nennt, übel mitgespielt worden. Sie waren Museumsdirektoren, Betriebsleiter, Facharbeiter, Hochschullehrer oder Bibliothekare mit enormer Sachkompetenz und wurden entlassen, weil sie in der Partei waren. Ein Bekannter war der Chef eines großen Unternehmens, hat seine Sache offensichtlich gut gemacht – nun hat er einen Vorstand aus dem Westen über sich, der dreimal soviel verdient und nur halb soviel kann (vielleicht verdient er sogar noch mehr, möglicherweise kann er sogar noch weniger).
Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. „Wenn du mich fragst: Der hat’s noch nicht kapiert!“ lautet der Lieblingsspruch einer Bekannten. Sie ist Dresdnerin und hat eine nette kleine Karriere hinter sich. Sie hat’s kapiert, hat die Mechanismen der freien Marktwirtschaft erkannt und es mit Kreativität und einer gehörigen Portion Arbeitswut geschafft. Bei all dem hat sie ihre Vergangenheit nicht geleugnet, wie es so viele Wendehälse lauthals taten.
Woran man die erkennt, die es noch nicht kapiert haben? Beispielsweise daran, daß sie gute alte DDR-Gepflogenheiten nahtlos in die Jetztzeit übernommen haben. Dazu gehört, sich Werkstatt—Termine fürs Auto mitten am Tag geben zu lassen, um möglichst weder vorher noch nachher zur Arbeit kommen zu müssen. Ein Werbegrafiker erzählte mir von einem Praktikanten, den er um ein Haar eingestellt hätte. Aber als er es ihm mitteilen wollte, ging das nicht: Der Kollege Praktikant hatte ohne große Rücksprache und trotz eines wichtigen Termins gerade freigenommen.
„Ich bin es leid!“ murrt auch der Marketingchef eines großen Dresdner Unternehmens. Drei Jahre hat er, der aus dem Westen kam und mit (damals fast) 50 noch einmal etwas bewegen wollte, der Stadt Impulse gegeben. Drei Jahre dauerte es, bis er für sich und seine Familie eine passable Bleibe fand. Nun sitzen sie alle im renovierten Altbau vor den Toren der Stadt und wundern sich, „wie es kommt, daß die Geschäfte in der Innenstadt samstags immer noch um elf schließen, wie es in der DDR gang und gäbe war. Und gar nicht wundern sie sich, daß es morgens um neun schon keine Brötchen mehr gibt: „Sie sind aus!“ – wie früher. Da hilft nur: auf Vorrat kaufen, einfrieren, samstags ausschlafen und die Brötchen einfach im Backofen aufbacken…
Was das heißt, er sei es leid, wollte ich wissen. „Nun“, meint er (und ist damit schon fast zum Sachsen mutiert, es ist nur noch ein Buchstabe zuviel. Nu! mit kurzem u und ansteigender Intonation ist der bewundernswert kurze Seufzer für alle Lebenslagen), „ich verlange, daß die Leute zuverlässig und korrekt arbeiten. Ich möchte, daß sie kreativ sind, daß wir zusammen etwas bewegen!“ Der Wunsch drückt aus, daß die Wirklichkeit davon oft weit entfernt ist: Allzu häufig signalisieren miesepetrige und unlustige Gesichter auch nach außen das Desinteresse und eine gewisse Lethargie am Arbeitsplatz.
„Um Gottes willen ist es denn wirklich so schlimm?“ fragt der Besuch aus dem Westen. Ja, ist es. „Und Warum bleibst du denn dann hier?“ Weil nicht alle so sind. Und weil es eine Menge Leute gibt, die so gar nicht in das geschilderte Klischee passen.
„Ich habe zwölf Jahre zu DDR-Zeiten in Dresden gelebt und war oft traurig, daß sich so wenig tut und die Häuser verfallen. Und da soll ich jetzt, wo sich in dieser Stadt endlich etwas ändert, sie einfach verlassen?“ fragt eine 32jährige Tourismus-Fachfrau. Schon damals war sie wütend, daß ausgerechnet die Guten das Land verließen – und das sei jetzt immer noch ein Problem: Wie soll sich denn dieses Land entwickeln, wenn die Macher alle gehen? „Ich bleibe“, sagt sie, „trotz alledem.“
 Ulrich van Stipriaan, 1993 erschienen in „Qualifix“ (Klett-Verlag)
Ulrich van Stipriaan, 1993 erschienen in „Qualifix“ (Klett-Verlag)


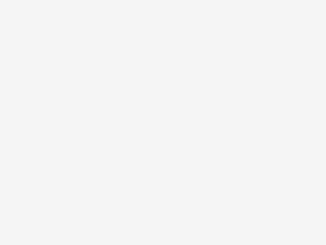

Hinterlasse jetzt einen Kommentar